Am Donnerstag, traf sich der zweistündige Geographiekurs der K2 um 8 Uhr im Foyer, um in Richtung Untertürkheim ins Mercedes-Benz Museum aufzubrechen. Nach einer kurzen Pause kamen wir gegen 9.30 Uhr am Museum an. Wir bekamen Audioguides, über die wir einige Informationen zu den verschiedenen Ausstellungstücken erhielten, was sehr hilfreich war. Ebenso war es sehr interessant, die Entwicklung des Automobils über mehrere Jahrzehnte zu verfolgen, von einem Eintaktmotor mit 12 PS bis hin zum V12 mit 630 PS. Für die meisten von uns war wohl die Ausstellung zu Ehren des 50-jährigen Bestehens von AMG interessant, in der die Supersportwagen des Haustuners zu sehen waren. Beeindruckend war auch die imposante Architektur dieses Museum, dessen Baukosten fast 900 Millionen Euro betrugen. Gegen 12 Uhr waren wir am Ende der Ausstellung angelangt und es ging wieder in Richtung Ostfildern zurück. Es war eine rundum gelungene Exkursion, bei der, so denke ich, alle sehr viel Spaß hatten.
(Philipp, K2)
Das Fach
Chemie - nur „wenn`s knallt und stinkt?“ – sicher nicht!
Denn die Chemie beschäftigt sich mit dem Aufbau von Stoffen, ihren Eigenschaften und ihren Umwandlungen. Somit steckt Chemie in allem, was um uns herum und auch in uns selbst passiert. Praktische Alltagsgegenstände sind ohne Chemie genau so wenig herstellbar und erklärbar wie technische High-End-Produkte oder auch unsere Natur.
Im Chemieunterricht werden allgemein naturwissenschaftliche aber auch speziell fachliche Arbeits- und Denkweisen vermittelt. Er verbindet in besonderer Weise die Schulung praktischer Fähigkeiten beim Experimentieren mit der Schulung theoretischer Fähigkeiten zur Erklärung der beobachteten Phänomene. Große, industrielle Prozesse, die unsere Konsumgesellschaft prägen, stehen thematisch neben den kleinen Dingen, die oft ohne, dass wir darüber nachdenken, unseren Alltag begleiten. Daneben ist auch die Verantwortung der Wissenschaft in Ökologie und Gesellschaft ein wichtiges Thema.
Chemie am HHG ist mehr!
- neu renovierte, hochmoderne Unterrichtsräume
- hervorragend ausgestattete Chemiesammlung
- viele durchdachte, spannende Experimente
- Exkursionen in die chemische Industrie
- Wettbewerbe, wie z. B. „Chemie, die stimmt!“
Nie zuvor gab es so viele „Bilder“ wie heute. Wir begegnen ihnen ständig und überall. Sie lösen Gefühle in uns aus und beeinflussen uns. Es ist ein großes Anliegen des Faches Bildende Kunst, ein bewussteres Verhältnis zu „Bildern“ unterschiedlichster Art zu vermitteln.
Im Kunstunterricht, der in der Regel zweistündig von Klasse 5 – 7 und einstündig von Klasse 8 – 10 stattfindet, lernen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken und Gefühle über praktische Arbeiten im Rahmen von Aufgabenstellungen zum Ausdruck zu bringen. Damit ist die Bildende Kunst ein ergänzender Gegenpol zu den verbal reproduzierenden Fächern am Gymnasium.
Das Profilfach Bildende Kunst bietet als vierstündiges Hauptfach in den Klassen 8-10 die Möglichkeit der vertieften Auseinandersetzung mit den Themenbereichen des Bildungsplans (Malerei, Grafik, Plastik, Architektur, neue Medien, Aktion).
Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der prozessorientierten Arbeit an Projekten (z.B. die Arbeit am Kunstgarten), sowie auf aufwendigen Techniken (z.B. Schattentheater, Radierung, etc.) und zusätzlichen Exkursionen (z.B. Staatsgalerie, Kunstmuseum, Lindenmuseum, Städtische Galerie Ostfildern,...).
Weitere Informationen zum Kunst-Profil
Die folgende Bildstrecke gibt einen Einblick in die künstlerischen Aktivitäten am HHG.
Das Heinrich-Heine-Gymnasium bietet in der Kursstufe regelmäßig Seminarkurse an.
Ziele eines Seminarkurses
Seminarkurse sollen die Teilnehmenden auf ein Hochschulstudium vorbereiten und ihnen dafür notwendige Arbeitstechniken vermitteln – daher auch der Name „Seminarkurs“. Die vermittelten Arbeitstechniken reichen von Literaturrecherche, Arbeiten mit Datenbanken über Erstellen einer Literaturliste, Zitiertechnik bis hin zur Erstellung einer schriftlichen Hausarbeit. Dazu nehmen die Schülerinnen und Schüler an einer Einweisung in der Stadtbücherei und ggfs. der Württembergischen Landesbibliothek teil. Vorträge und Projekte runden das Angebot ab. Außerdem bietet der Seminarkurs die Möglichkeit, sich intensiver und fächerübergreifend mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Leistungsnachweise und Bewertung
Im Rahmen des Seminarkurses müssen die Teilnehmenden verschiedene Leistungen erbringen, zum Beispiel Kurzpräsentationen zu einem Thema, Exzerpte oder Abstracts erstellen, Zitierübungen erledigen, Literaturlisten erstellen und eine formal korrekte schriftliche Facharbeit verfassen.
Die Endnote ergibt sich aus den mündlichen und schriftlichen Leistungen während der Seminarfachsitzungen (50%) und der Seminarfacharbeit (25%) und dem Kolloquium (Präsentation und Prüfungsgespräch 25%). Der Seminarkurs kann für das Abitur angerechnet werden und kann bei entsprechender Fächerwahl die Präsentationsprüfung in einem 5. Abiturfach ersetzen. Die Seminarkursnote steht in jedem Fall im Abiturzeugnis, auch wenn sie nicht angerechnet wird.
Seminarkurs 2022/2023 - Krieg und Frieden
Wie in jedem Jahr bietet das HHG einen Seminarkurs an – in diesem Jahr erstmals unter der Leitung von Frau Oehmke und Herrn Kuse. Erfreulicherweise stößt dieses Angebot auf großes Interesse bei den Schüler*innen, wohl auch aufgrund der aktuellen Thematik, die uns seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine täglich in den Nachrichten begegnet.
Beim Seminarkurs handelt es sich um einen Kurs, der freiwillig in der K1 belegt werden kann. Die Schüler*innen lernen, wie man eine wissenschaftliche Arbeit erstellt und werden nach und nach an diese Herausforderung herangeführt. So haben unsere Schüler*innen beispielsweise bereits eine Rechercheschulung in der Stadtbibliothek Stuttgart besucht (siehe Bilder) oder überprüft, woran man erkennen kann, welchen Internetquellen zu trauen ist – und von welchen man im Rahmen einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit vielleicht besser die Finger lassen sollte. Nach erfolgreichem Training wird jeder Kursteilnehmer eine eigene Seminararbeit verfassen. Eine mündliche Präsentation der Forschungsergebnisse schließt sich an. Das fachliche Niveau der Aufgaben liegt dabei recht hoch – schließlich kann die Teilnahme am Seminarkurs auf Wunsch eine mündliche Abiturprüfung ersetzen.
In ihren Hausarbeiten befassen sich die Schüler*innen dieses Seminarkurses unter anderem mit Themen wie: Gibt es eine Friedensformel? War das westliche Nation Building im Irak zum Scheitern verurteilt?, Deutsche Kindersoldaten im zweiten Weltkrieg - Opfer oder Täter?, War der Anschlag 9/11 ein Verstärker der Islamfeindlichkeit in den USA?, War die Sowjetunion schuld am Kalten Krieg?, Jugoslawien - ein Staat zum Zerfall verdammt?, Gibt es ein klassisches Terroristenprofil?
Die betreuenden Kollegen hoffen, den Schüler*innen ihres Seminarkurses nicht nur das notwendige Rüstzeug, sondern auch Freude am wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln und so den Einstieg in ein Studium, in dem das Erstellen solcher Arbeiten in vielen Studienfächern elementar ist, zu erleichtern.
(Anne Oehmke und C J Kuse)
Seminarkurs 2021/2022 - Nicht alles ist schwarz oder weiß – Seminarkurs zum Thema Farben
Das gilt erst recht für die Schule, denn in Farbe sieht die Welt gleich besser aus. So beschäftigt sich unser diesjähriger Seminarkurs mit einem ganz bunten Thema: Farben. Die Themenvielfalt der einzelnen Arbeiten reicht in vielfältige Bereiche: von den Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften in die Sozialpsychologie bis hin zu historischer Waffenkunde. So beschäftigen sich die Schüler*innen mit Fragen über die Bedeutung von Farben in unserem Alltag, aber auch mit der Entstehung von Polarlichtern, mit den Auswirkungen parteipolitischer Farben, mit der Modernität und Effektivität von Biolumineszenz oder Farbsynästhesie. Welche Kleidung tragen wir? Welche Produkte kaufen wir? Welche Marken halten wir für edel? Auch wirtschaftlicher Entscheidungen fußen nicht selten auf Farbwahrnehmung und Farbeinordnung. Und sie wandeln sich ebenso mit der Zeit wie beispielsweise geschlechtstypische Farben oder die Bedeutung von Farben auf Wappen. Es gibt also einiges zu erkunden. Damit unsere Schüler*innen auch die Möglichkeit haben, die HHG-Gemeinschaft einzubeziehen, wird es einen Thementag geben, an dem die Schüler*innen des Seminarkurses Erlebnisräume gestalten und zu kleinen Experimenten einladen. Um darauf schon einmal einzustimmen, wird es auf der Homepage kurz vor Weihnachten kleine Einblicke, Texte und Bilder geben. (Julia Schönthaler und Andrea Pohlner)
Seminarkurs 2020/2021 - Nachhaltige Ernährung und körperliche Fitness im Kontext des Klimawandels
Der Seminarkurs Nachhaltige Ernährung und körperliche Fitness im Kontext des Klimawandels widmet sich einem der aktuellen Themen unserer Zeit: Klimawandel und Nachhaltigkeit. Den Schüler*inneninnen soll über die Zugänge Ernährung und Sport ein persönlicher Bezug zu diesen Themen aufgezeigt werden, denn jeder kann durch seinen eigenen Lebenswandel einen Beitrag zum Erhalt unserer Erde leisten. Der Seminarkurs zielt darauf ab, dass die Teilnehmer*innen die Grundlagen der Ernährungswissenschaften und Trainingswissenschaften in Theorie und Praxis erfassen, anwenden und im Kontext des Klimawandels einen nachhaltigen Lebenswandel entwickeln bzw. ausbauen. Die Teilnehmer*innen sollen Wege zur aktiven Förderung der eigenen Gesundheit erlernen und in der Folge ihr Umfeld für eine nachhaltige Ernährung und körperliche Fitness im Kontext des Klimawandels sensibilisieren können.
Von den Teilnehmer*innen wird erwartet, die Inhalte des Seminars in Präsenzphasen und in Phasen des begleiteten Selbststudiums zu erschließen und umzusetzen. Unter Berücksichtigung eines anstehenden Hochschulstudiums werden wissenschaftliche Methoden und Arbeitsweisen eingeführt und in der Anfertigung einer Seminarfacharbeit angewandt und vertieft.
(Johannes Kühne und Dieter Liedtke)
Seminarkurse der vergangenen Jahre
- 2022/23: Krieg und Frieden
- 2021/22: Nicht alles ist schwarz oder weiß – Seminarkurs zum Thema Farben
- 2020/21: Nachhaltige Ernährung und körperliche Fitness im Kontext des Klimawandels / Hirnforschung
- 2019/20: Judentum, Israel und der Nahostkonflikt
- 2018/19: Politisierung des Sports früher und heute
- 2017/18: Glück
- 2016/17: Das Gehirn: das coolste Organ von allen
- 2015/16: Zukunft 4.0. – Leben mit künstlicher Intelligenz
- 2014/15: Was darf der Mensch? – Aktuelle Fragen der Bioethik
- 2013/14: Ernährung
- 2012/13: Mythos China – Land zwischen Tradition und Moderne
Recht früh ging es am 06.10.2020 am HHG für den Leistungskurs Biologie der K2 los in Richtung NeuroLab der Universität Tübingen. Das NeuroLab ist ein Schülerlabor, in dem wir einen Einblick in die Neurowissenschaften und die Arbeit eines Wissenschaftlers bekommen durften. Nach zwei Stunden Bus- und Bahnfahrt, waren wir endlich da. Dort wurden wir von Professor Ilg der Uni Tübingen und seinem Team an Bufdis, FSJlern und Studenten, in Empfang genommen und machten uns direkt an die Gruppeneinteilung. Insgesamt gab es sechs Gruppen welche sich mit verschiedenen Bereichen unseres Nervensystems beschäftigten: Es gab Gruppen zum Thema psychophysischem Hören, motorischem Lernen, Aufmerksamkeit, Blickbewegungen sowie Übertragungen zu elektrischen Fischen und der Programmierung eines kleinen Roboters. In die Teams aufgeteilt erhielten wir alle nun eine spezielle Einweisung in unser Thema von einem Betreuer.
Beim Wettbewerb "Mathematik ohne Grenzen" im Februar 2020 brillierte die Klasse 9c mit einem neuen Rekord: Sie schaffte es auf den 10. Platz von insgesamt 140 Klassen, die im Regierungsbezirk Nord-Württemberg teilnahmen. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten HHG-MoG-Team!
Der internationale Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ wird seit 2008 im Bezirk Nord-Württemberg unter Leitung des Heinrich-Heine-Gymnasiums durchgeführt. Dabei ist das Mathe-ohne-Grenzen-Team des HHG, aktuell unter Leitung von Frau Kastl, zusammen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart für die Organisation und die Korrektur der Aufgaben, sowie für die alljährliche Ausrichtung der Siegerfeier in Stuttgart verantwortlich, welche aber leider dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte.
Ziel des Wettbewerbs ist es, Interesse und Freude am mathematischen Problemlösen zu entwickeln und Initiative und Kreativität der Schüler zu fördern. Erfolg ist dabei nur durch Teamarbeit möglich, denn jeder wird gebraucht und jeder kann sich je nach Begabung einbringen. Geschickte Selbstorganisation der Klasse und effektive Zusammenarbeit der Schüler ist dabei von entscheidender Bedeutung. Außerdem sind Fremdsprachenkenntnisse gefragt, denn eine Aufgabe muss in einer modernen Fremdsprache bearbeitet werden. Die Aufgaben erfassen die verschiedensten, auch anscheinend nicht mathematischen Gebiete, wobei weltweit die gleichen Aufgaben gestellt werden. Finanziell wird die Durchführung im Bezirk Nord-Württemberg durch den Klett-Verlag und die LBBW Stiftung, die Dieter Schwarz Stiftung, die Wiedeking Stiftung sowie vom Regierungspräsidium Stuttgart unterstützt.

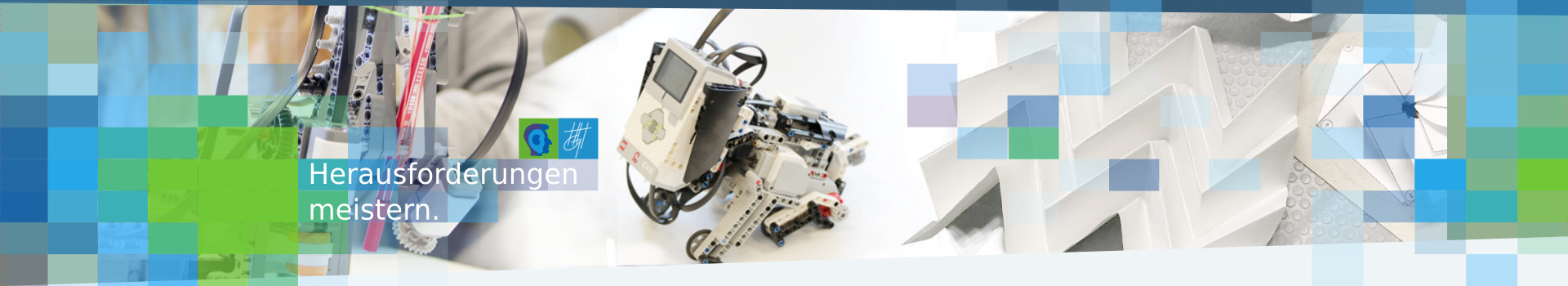
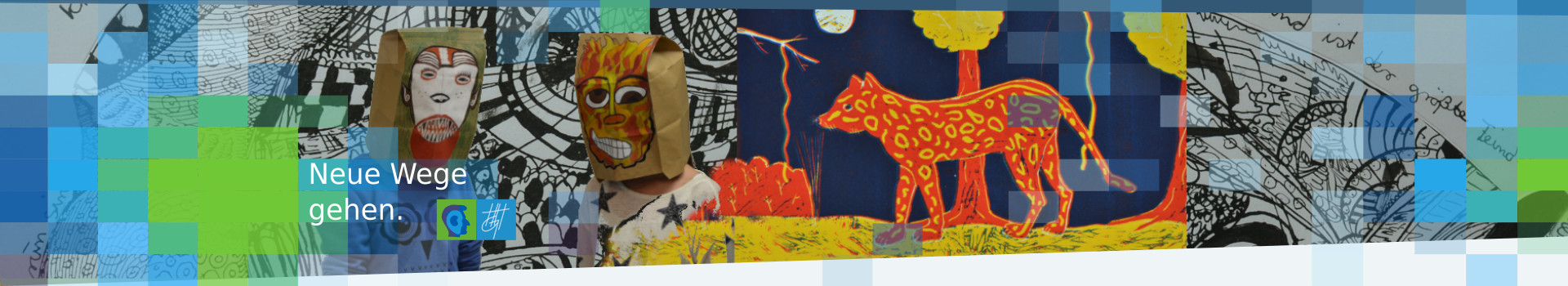





















 WebUntis: Stundenplan / Vertretungsplan
WebUntis: Stundenplan / Vertretungsplan